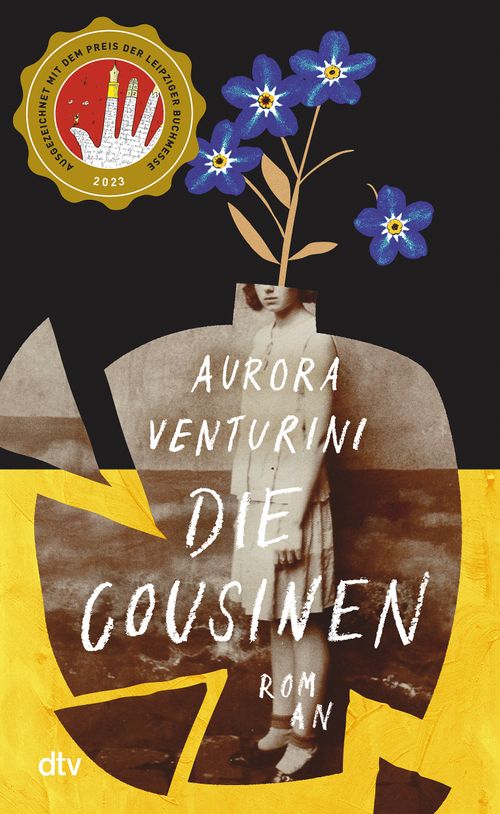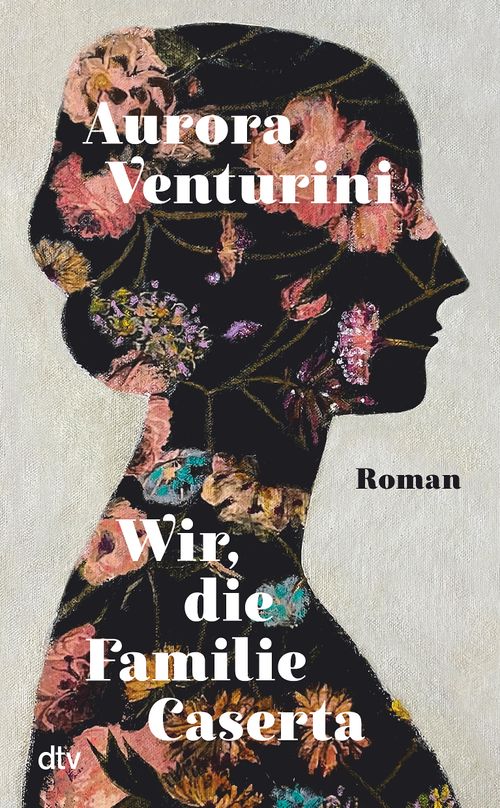Übersetzerin Johanna Schwering über ›Die Cousinen‹ von Aurora Venturini
Johanna Schwering wurde für ihre Übersetzung von Aurora Venturinis Roman ›Die Cousinen‹ mit dem Leipziger Buchpreis 2023 ausgezeichnet. Im Interview erzählt sie von der Arbeit an diesem herausfordernden Text und von Aurora Venturini als einer der souveränsten und originellsten literarischen Stimmen überhaupt.
Olga Tsitiridou (dtv): Sie haben den Preis der Leipziger Buchmesse 2023 für Ihre Übersetzung von Aurora Venturinis ›Die Cousinen‹ gewonnen. Was ist das für ein Gefühl, wenn die eigene Arbeit so viel Anerkennung erfährt?
Johanna Schwering: Das ist natürlich ein großartiges Gefühl, ich habe es noch gar nicht richtig begriffen. Für mich ist die ganze Aufmerksamkeit auch gewöhnungsbedürftig. Ich arbeite vor allem als freie Lektorin und meistens wird meine Arbeit von genau zwei Personen überhaupt gesehen und anerkannt: Autor*in oder Übersetzer*in und Auftraggeber*in. Als Übersetzerin habe ich im literarischen Bereich bisher vor allem Lyrik übertragen, das lesen in der Regel ja auch nur ein paar Hundert Leute.
Aurora Venturinis ›Die Cousinen‹ gilt als Sprachkunstwerk. Wie herausfordernd ist die Übersetzung eines Werks, dessen Sprache und Stil so besonders ist?
Sehr herausfordernd. Die Protagonistin und Ich-Erzählerin des Buches, die jugendliche Yuna, setzt sich sehr aktiv mit Sprache auseinander und gerät dabei immer wieder an ihre Grenzen. Die Erschöpfung, die Yuna in diesem Prozess beschreibt, konnte ich beim Übersetzen sehr gut nachvollziehen, ich habe mich komplett verausgabt und selbst diese Erschöpfung erlebt. Ich durfte mich hier sprachlich aber auch genauso austoben wie die Erzählerin, und das war toll.
Sie haben in einem Interview einmal gesagt, dass Sie immer wieder Übersetzungspausen brauchen.
Ja. Das war eine Übersetzung, die ein bisschen reifen musste. Ich musste sie immer wieder mit Abstand anschauen und auch einiges ausprobieren, bis ich zu dem Sound gekommen bin, den Sie jetzt lesen. Es ist ja ein sehr unkonventioneller Text, stilistisch gesprochen, den kann ich mir als Übersetzerin nicht so ungefiltert und intuitiv vom Leib schreiben, wie die Autorin es vermutlich gemacht hat. Venturini hat das Buch in nur zwei Monaten geschrieben und ziemlich sicher auch kein Lektorat erfahren. Als Übersetzerin musste ich versuchen, all die verschiedenen Ebenen und auch die vielen Brüche, die in dem Text stecken, erstmal zu identifizieren, um sie dann möglichst wirkungsäquivalent nachzuerzählen.
An einer Stelle des Romans heißt es: »Der dicke Dachdecker deckt dir dein Dach. Drum dank dem dicken Dachdecker, der dir dein Dach deckt.« Ich frage mich, ob man bei der Übersetzung solch eines Zungenbrechers aus dem Spanischen ins Deutsche auch verzweifeln kann.
Ja, ich verstehe den Gedanken. Tatsächlich war dies aber ein vergleichsweise dankbarer Fall zur Übersetzung. Im Original steht ein Zungenbrecher, in dem eine gewisse María Chucena das Dach ihrer Hütte deckt und ein Holzfäller sie fragt, warum sie dieses und kein anderes Dach decke. Die Laute, die mit dem Zungenbrecher geübt werden sollen, sind im Original andere als in der Übersetzung, aber das ist irrelevant für die Erzählung. Ich habe einfach eine Liste deutschsprachiger Zungenbrecher durchgelesen und hatte einen ganzen Haufen zur Auswahl, die alle super klangen. Das war eine sehr amüsante Recherche. Für den Dachdecker habe ich mich entschieden, weil er thematisch nah am Original bleibt und außerdem im Kontext des Romans auch auf Schlüsselthemen wie Missbrauch und Verrat vorausdeutet. Etwas ähnlich Doppeldeutiges schwingt in dem Zungenbrecher im Original auch mit.
Wie sehr mussten Sie für diese Übersetzung in Aurora Venturinis Welt eintauchen, und was war das für ein Gefühl, als Sie die fertige Übersetzung aus der Hand gelegt haben?
Die von Missbrauch und Katastrophen durchfurchte Lebenswelt von Venturinis ›Die Cousinen‹ ist zum Glück weit weg von meiner eigenen. Das Eintauchen war hier also eher abstrakter Art. Ich habe mir einfach den Kopf zerbrochen über diverse sprachgestalterische und syntaktische Fragen. Natürlich habe ich auch alles gelesen, was über Venturini zu der Zeit schon geschrieben war, das war allerdings nicht sehr viel. Die Autorin wird auch von der Literaturwissenschaft gerade erst entdeckt. Die meiste Arbeit fand hier werkimmanent und auf der sprachlichen Ebene statt. Und zu der zweiten Frage: Es ist schwer, eine so komplexe Übersetzung als »fertig« zu begreifen. Es kommt einfach der Moment, wo man loslassen und das Werk ins Lektorat und dann in den Satz entlassen muss. Als ich das gedruckte Buch zum ersten Mal aufgeschlagen habe, war ich erleichtert, dass ich mich sofort wieder selbst an der Übersetzung erfreuen konnte. Ich lese unglaublich gerne aus dem Buch vor. Ich denke, das ist ein gutes Zeichen. Es sind aber auch schon diverse Korrekturzettel in meinem Arbeitsexemplar. Vieles würde ich heute, ein Jahr später, schon anders machen. Hier noch etwas umstellen, da noch ein Komma tilgen.
Was ist das Besondere an Aurora Venturinis literarischer Stimme bzw. an ihrem Roman ›Die Cousinen‹? Was macht seine Unverwechselbarkeit aus und wie würden Sie ihn literaturgeschichtlich einordnen?
Für mich ist Aurora Venturini definitiv eine der souveränsten und originellsten literarischen Stimmen, die ich überhaupt kenne. Sie ist mutig, anarchisch und sehr komisch. Ich schätze mich überglücklich, sie übersetzen zu dürfen, und werde nicht müde zu betonen, dass wir es hier mit einer Autorin von weltliterarischem Format zu tun haben. Ich hoffe, dass ihr Name bald in alle Literaturgeschichten eingeht, angefangen bei den feministischen, den romanistischen und denen, die aufs 20. Jahrhundert schauen. Und da der literarische Betrieb so stark über Referenzen funktioniert: Die Vergleichsautorinnen, die mich bisher als Referenz zu Venturini am meisten überzeugt haben, haben mir zwei kluge Leserinnen genannt, und sie heißen Emine Sevgi Özdamar und Tove Ditlevsen.
Ist es schwierig, während des Übersetzens die Freude an der Literatur selbst nicht zu verlieren? Anders gefragt, fällt einem das Übersetzen leichter, wenn man das Buch, das man übersetzt, liebt?
Ich kann für mich sagen, dass ich auf solch hohem literarischen Niveau nur Bücher übersetzen möchte, die mir wirklich gut gefallen. Man verbringt ja Monate seines Lebens mit dem Werk. Diese Arbeit ist nicht sehr gut bezahlt, da muss die Freude dran umso größer sein, um das zu kompensieren. Auf hohem literarischen Niveau habe ich auch den Anspruch, mich mit dem Werk identifizieren zu können. Aber ich habe auch eine Reihe Unterhaltungsromane übersetzt und daran sehr viel Spaß gehabt. Einer der vielen schönen Aspekte an dieser Arbeit ist, dass man definitiv mit jedem Text, den man übersetzt oder lektoriert, etwas Neues lernt.
Übersetzer*innen werden sehr oft als Idealist*innen bezeichnet. Auch, weil dieser Beruf, was die Bezahlung betrifft, zu wenig Wertschätzung erfährt. Woran kann das liegen und gibt es Wege, dies endlich zu ändern?
Jetzt stellen Sie die ganz großen Fragen. Das hat multiple Ursachen und es gibt gute Initiativen, um die Lage zu verbessern. Zum einen steckt in vielen Köpfen immer noch der Mythos, mit Schreiben, Übersetzen, Lektorieren mache man eigentlich sein Hobby zum Beruf – jede Leseratte kann das doch und soll sich glücklich schätzen, dafür noch Geld zu bekommen. Das ist natürlich Unsinn. Dennoch haben die meisten Menschen, die sich für diese Berufe entscheiden, leider tatsächlich keinen ausgeprägt unternehmerischen Sinn. Wenn es um Zahlen, Geld, Verhandlungen geht, stecken sie lieber den Kopf in den Sand. Wir verhandeln als Übersetzende ja außerdem als Soloselbständige mit großen Konzernen als Gegenüber, da gibt es eine hierarchische Schieflage zu unseren Ungunsten. Deshalb ist es wichtig, dass in den Verbänden der Übersetzenden und Lektorierenden das betriebswirtschaftliche Denken geschult und dass politisch Druck für bessere Honorare gemacht wird, wie etwa jüngst durch die ver.di-Initiative Basishonorare für selbständige Kreative. Kampagnen wie #NameTheTranslator, die die Namen der Übersetzenden in Rezensionen und auf dem Cover fordern, sind wichtig, denn mit steigender Sichtbarkeit wird auch die Wertschätzung für den Beruf und damit langfristig die Honorierung steigen. Agenturen könnten eine Lösung sein, wie Autor*innen sie beschäftigen. Die Honorare für Übersetzende stagnieren seit über 20 Jahren und ich sag es Ihnen ganz nüchtern und ernüchternd: Erst, wenn ich dieses Preisgeld mit verrechne, komme ich bei der Übersetzung von ›Die Cousinen‹ auf einen Stundensatz, für den ein Programmierer vielleicht langsam seinen Rechner anschmeißen würde. Wie für alle künstlerischen Berufe sind deshalb auch für die literarische Übersetzung Stipendien und Preise total wichtig, um die Anerkennung für unsere Arbeit zu erhöhen und bestimmte Projekte überhaupt erst realisierbar zu machen.
Zum Abschluss noch die Frage: Woran arbeiten Sie gerade?
An der Übersetzung eines zweiten Romans von Aurora Venturini. Ein weiteres großartiges Werk der Autorin, ich finde es mindestens so gut wie ›Die Cousinen‹. Es liest sich wie ein Spiegelbild der ›Cousinen‹, dabei hat die Autorin es schon 40 Jahre früher geschrieben. Der Plot ist noch exzentrischer, die Erzählweise aber konventioneller, syntaktisch gesprochen. ›Wir, die Familie Caserta‹ erscheint im Januar 2024 bei dtv, ich empfehle es sehr. Und ja, die Arbeit daran ist wieder eine große Freude. :o)
Interview: Olga Tsitiridou (dtv), Juni 2023
Betritt man unser Verlagsgebäude ist Olga Tsitiridous Gesicht das Erste, das einem vom Empfang entgegenstrahlt. Für das dtv Magazin stellt Olga regelmäßig ihre persönlichen Lese-Highlight aus dem aktuellen Programm vor, lässt aber auch immer wieder ihren Schreibtisch zurück und macht sich auf die Suche nach neuen, spannenden Stories über alles, was ein Bücherherz bewegt.